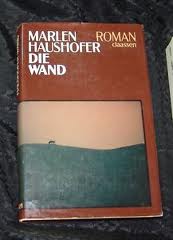Berlinale: Gucken – nicht gucken – lieber lesen
Von
Heute hat der Vorverkauf für die Berlinale-Tickets begonnen, hier also rasch noch ein paar Tipps: Wäre Miranda July Japanerin, sie würde bestimmt einen ähnlich poetischen Film wie Naoko Ogigami, die schon 2008 mit „Menage (Glasses)“ bezauberte, machen.. „Rentaneko (Rent-a-cat)“ erzählt die – stellenweise herrlich absurd-komische – Geschichte einer eigensinnigen, jungen Frau, die an einsame Menschen Katzen verleiht…Der Film feiert auf der Berlinale seine Weltpremiere in der Panorama-Sektion.
Ähnlich poetisch, aber ernsthafter ist „L’age Atomique (Atomic Age)“ ein Film der Französin Héléna Klotz. In traumhaft-alptraumhaft-reduzierten Bildern wird die Geschichte zweier junger Männer, die sich im Pariser Nachtleben amüsieren wollen, aber auch zu vergessen suchen, erzählt. Der hypnotisierende Film hat die Atmosphäre einer Frage, die einer der Protagonisten mal seinem Freund stellt „Wenn etwas passiert und niemand darüber redet – passiert es dann trotzdem?“ Ein Film, in den sich unsere pubertierenden Söhne gerne verirren dürften…Mein persönlicher Lieblingssatz dieses „bisexueller-Werther-tanzt-zu–John-Maus-Films“: „We should dim the cities and return to the blackest lights…“ Hach.
Wer bei dem Wort Bahndammbrand schmunzeln muss und es sympathisch findet, wenn jemand auf die Frage, welche Ziele man im Leben verfolgt, antwortet: „Ich will mal endlich essen ohne zu kleckern lernen“ ist bei dem Film „Dichter und Kämpfer“ über die Poetryslamszene in Deutschland gut aufgehoben. Die Regisseurin Marion Hütter begleitet u.a. die junge Newcomerin Theresa Hahl durch ihr von etlichen Poetryslams gespicktes Jahr, in dem sie zum Szenestar avanciert. Der Film ergründet, was Theresa und die anderen („Scharri“, Sebastian23 und Julius Fischer) antreibt, sich jeden Abend dem Publikum zur Abstimmung zu stellen. Eines kristallisiert sich rasch heraus, diesen sympathischen Nerds ist es einfach lieber „Flausen im Kopf und keine Steine im Magen“ zu haben…
[youtube width=“425″ height=“355″]http://www.youtube.com/watch?v=cN_GwrfapKo[/youtube]
Grauenvoll öde ist allerdings der erste und hoffentlich letzte Film von Tim Staffel, das Erdnussgeknuspere meines Hintermannes fand ich weitaus spannender als Staffels Debütfilm „Westerland“. Wer allerdings auf minutenlange sich-auf-dem-Klo-übergeben-Szenen steht oder seine Kinder vorm Kiffen warnen möchte – wegen totaler Abschlaffungsgefahr – der ist bei diesem Film-Antiereignis bestens aufgehoben. Mir erging es jedenfalls so, dass gerade im recht politischen Berlinale-Kontext die Luxusprobleme von Menschen, denen es vergleichsweise prima geht, mir gehörig auf den Senkel gehen. Du sollst nicht kiffen, du sollst nicht kotzen, du sollst nicht sterben schreibt Jésus (kein Kommentar) irgendwann vor lauter Welt-und Beziehungsfrust an die Wand. Am liebsten wäre ich aufgestanden und hätte noch auf die Leinwand geschrieben: Und Du sollst keine sterbenslangweiligen Filme machen!
Jetzt dagegen bereits Geheimtipp und einer meiner Favoriten der diesjährigen Berlinale: „This ain’t California“ von Marten Persiel. Worum geht’s? Um die Rollbrettfahrerszene (ostdeutsch für Skaterszene) in der späten DDR – d.h. 70er Jahre bis zum Herbst 1989. Jaja,so was gab’s dort tatsächlich. Das durch crowdfunding teilfinanzierte Punkmärchen ist ein filmischer Nachruf auf den ehemaligen Skater Denis, der für seine früheren Wegbegleiter völlig überraschend bei einem Afghanistaneinsatz ums Leben kam… Dieser Film ist eine mitreißende Hymne an die Freiheit, die Freundschaft, die Berliner Schnauze, die Subkultur, die Lebenslust, die Selbstbestimmung und Super-8-Filmmaterial. Schade finde ich nur, dass es sowohl in Ost als auch West erst viel später weibliche Skater gab, 2004 durften junge Frauen beispielsweise zum ersten Mal beim Monster Mastership mitmachen. Aber wenigstens gab es schon damals die 18-jährige „Hexe“, die einen Ollie über die Berliner Mauer machte, indem sie immer wieder in die DDR reiste und über die dortige Skaterszene berichtete….
[youtube width=“425″ height=“355″]http://www.youtube.com/watch?v=h7B1aekALwo[/youtube]
Noch ein Film, den frau sich dagegen vielleicht besser nicht anschauen sollte – aber aus ganz anderen Gründen – ist „Die Wand“ von Julian Roman Pölsler. „Endlich stellte ich mich meinen Gedanken, dabei kam gar nichts heraus“ sagt Martina Gedeck tonlos als die namenlose Frau in der Verfilmung des geleichnamigen Romans von Marlen Haushofer. Das Publikum lacht, obwohl kurz zuvor der einzig verbliebene Freund der Frau, ihr treuer Hund Luchs getötet wurde. (Und obwohl der Drehbuchdoktor Syd Field am Skript als dramaturgischer Berater beteiligt war.) Lest ihr stattdessen den Roman lacht ihr an dieser Stelle garantiert nicht, zu sehr ist das Leser-Ich bereits mit dem dieser unnahbaren Frau verschmolzen, die eigentlich nur mit ihrer Cousine und deren Mann einen Wochenendausflug in eine Jagdhütte in den Bergen machen wollte. Doch ihre Verwandten kehren von einem Ausflug ins Dorf nicht zurück. Als sie sich auf die Suche nach den beiden macht, entdeckt sie etwas Schreckliches, eine vollkommen unsichtbare Wand mitten in der Natur, die sie fortan vom Rest der Welt trennt. Jetzt sind die Frau, der zurückgebliebene Jagdhund, eine trächtige Kuh und eine Katze, die ihr später zuläuft, allein auf sich gestellt und die Frau muss sich ihren schlimmsten Ängsten stellen, die sie immer wieder in einen Abgrund der Verzweiflung und des Wahnsinns zu reißen drohen. Der Roman „Die Wand“ stammt aus dem Jahre 1963 und avancierte in den Achtziger Jahren zum Kultbuch der Frauenbewegung – ich erinnere mich noch genau als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, wie fasziniert ich von diesem radikalen weiblichen Entwurf eines selbstbestimmten Lebens war und wie ich mich bereits nach wenigen Seiten ebenfalls in der Jagdhütte einrichtete. Ich schließe die Augen und erinnere mich, wie paralysiert ich von Textstellen wie dieser war: „Ich suchte nicht mehr nach einem Sinn, der mir das Leben erträglicher machen sollte… Seit meiner Kindheit hatte ich es verlernt, die Dinge mit eigenen Augen zu sehen, und ich hatte vergessen, dass die Welt einmal jung, unberührt und sehr schön und schrecklich gewesen war. Die Einsamkeit brachte mich dazu, für Augenblicke ohne Erinnerung und Bewußtsein noch einmal den großen Glanz des Lebens zu sehen.“ Dem Regisseur Julian Roman Pöhler ging es wohl ähnlich wie mir, bezeichnet er „Die Wand“ im Presseinfo als sein „Lebensbuch“ – es soll mir an dieser Stelle erlaubt sein, dies zumindest erstaunlich zu finden, handelt es sich meiner Meinung nach doch um eine apokalyptische Utopie in der auch das kollektiv erfahrene Leid der Frauen bis zu den 60er Jahren als stetiger Unterstrom spürbar ist. Gegen Ende der Geschichte wird ein anderer Überlebender, ein wie ein Wahnsinniger agierender Mann, der die Tierschützlinge der Frau bedroht, von dieser folgerichtig erschossen. Ein „Lebensbuch“ von dieser utopischen Sprengkraft sollte Mann – und meiner Meinung nach auch nicht Frau – lieber nicht verfilmen. Dieses Buch ist soviel mehr als eine „Was-wäre-wenn-Geschichte“ und das Medium Film stößt bei solchen „Kopfkino-Geschichten“ rasch an seine Grenzen – selbst wenn man sich wie Pöhler recht eng an die Vorlage hält und – mittels Voice over – ganze Textpassagen der gegen den Wahnsinn anschreibenden gealterten Frau getreu wiedergibt.
Während der Abspann noch läuft, fragt eine Kollegin ein wenig abgetörnt die andere: „Hast Du jetzt auch noch Lust das Buch zu lesen?“ Ja sage ich, diese weibliche Robinsonade gehört zum eindringlichsten, was ich in meinem Leben gelesen habe und auch ich werde das Buch nach so vielen Jahren noch einmal lesen, denn keine noch so beeindruckend agierende Martina Gedeck kann an meine namenlose Frau heranreichen.